Partner
Services
Statistiken
Wir
Interview mit CHARLIE BARNES (09.03.2018)

Foto: Sara J. Warilow / SS Creative Photography
Leben, leiden und altern als Musiker
Charlie Barnes hat mit „Oceanography“ ein nahezu aus der Zeit gefallenes Album veröffentlicht, das die Tugenden des kunstvoll exaltierten Pop aufrechterhält, und spricht darauf dennoch brandaktuelle Themen an – sowohl für sich selbst als einen Kulturschaffenden als auch den Jedermann, der dieser wunderlichen Scheibe hoffentlich Beachtung schenken wird.
Charlie, in Deutschland kennt man dich vor allem aus dem Vorprogramm einer Tournee von Amplifier und als deren Verstärkung auf der Bühne. Da du aber stilistisch viel facettenreicher unterwegs bist: Würdest du bitte kurz rekapitulieren, wie du zur Musik gefunden hast und an den jetzigen Punkt gelangt bist?
Also, Amplifier sind schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie waren zuerst eine meiner Lieblingsbands, sind Freunde und schließlich auch meine Mitmusiker geworden. Mittlerweile haben wir mehrere Jahre gemeinsam auf Reisen verbracht, wobei ich nicht nur dein Einheizer gab, sondern auch Gitarrentechniker war und Merchandise verkaufte, ehe ich dann auch mit ihnen auf die Bühne trat. Im Laufe jener Tourneen lernte ich Amplifiers Steve Durose immer besser kennen, und irgendwann beschlossen wir, etwas zusammen an den Start zu bringen. Durch ihn und Sel, den Kopf der Band, landete ich letztlich bei Superball Music, die sich für meine Solosachen interessierten. Vor ein paar Jahren im Vorfeld der Veröffentlichung meines ersten Albums erhielt ich den Zuschlag für einen ziemlich bedeutenden Job – Aushilfsmusiker auf Tournee für den Pop-Act Bastille, worauf ich mich dann längere Zeit konzentriert habe. Dabei erlebte ich unglaubliche Dinge, und mein Engagement mit der Gruppe dauert weiter an. Bei meiner Hochzeit hockten die Mitglieder beider Bands an einem Tisch …
Warum hast du die neuen Songs unter dem Titel „Oceanography“ zusammengefasst – weil du in bisher unerschlossene Breiten aufgebrochen bist?
Auf keinen Fall. Sind wir ehrlich: Heutzutage erschließt doch kaum mehr jemand musikalisches Neuland. Populärmusik – und diesen Begriffe fasse ich sehr generell auf – existiert schon seit unheimlich langer Zeit, und meines Erachtens findet man die interessantesten Künstler im Augenblick in ganz anderen Genres, wo sie auf spannende Weise mit unterschiedlichen Stilelementen jonglieren. Als Beispiel dafür werde ich nicht müde, The Killers anzuführen, die dramatische Melodien und Harmonien aus dem klassischen Americana-Bereich mit dem Synth Pop der 1980er kombinieren und aggressiven Gesang wie im Garage Rock darüberlegen. Ich vergöttre diese Band, sie ist etwas ganz Besonderes für mich, doch um auf den Titel zurückzukommen … Er lässt sich auf zweierlei zurückführen; erstens spielt er auf Oceansize an, die ich mir auf ewig als Maßstab für mein eigenes Schaffen vorhalte, und zweitens liegt „Oceanography“ die Metapher zugrunde, lediglich ein Tropfen im Meer oder auf dem heißen Stein zu sein. Als nicht sonderlich bekannter Künstler, der im Internetzeitalter im Kleinen vor sich hin werkelt, fühlt man sich mitunter überwältigt und verliert rasch den Mut. Damit setze ich mich in vielen der aktuellen Stücke auseinander, wobei ich versucht habe, nicht zu wehleidig daherzukommen. Hoffentlich erkennen die Hörer, dass ich mit ‚All I Have‘, einer hübschen Ballade über meine Ehefrau, ein zuversichtliches Fazit ziehe.
Das Album ist dahingehend bemerkenswert, dass es vielschichtige Arrangements, das Verschwenderische und Prunkvolle von Queen, Electric Light Orchestra oder Roxy Music hochzuhalten scheint. Findest du, dass die ausgefallene Ästhetik dieser Gruppen im seichten Einerlei des gegenwärtigen Mainstream unbedingt bewahrt werden sollte?
Oh, falls meine Songs solche Vergleiche nach sich ziehen, fasse ich das als riesiges Kompliment auf, danke! Durch Queen fand ich überhaupt erst zur Musik, als ich noch klein war, weshalb sich wohl nachvollziehen lässt, dass sie sich immer irgendwie in meinen eigenen Kompositionen niederschlagen. Das betrifft vor allem den Gesang, mit dem ich mich bemühe, selbstbewusst und überschwänglich theatralisch zu klingen. Ich bin ein großer Freund des Vermächtnisses des Pop der 1970er, das du meinst. Aus jener Zeit stammt so viel großartige Musik. Die Bands hatten unfassbare Ideen zwischen dem Nachlass der Beatles und progressivem Rock, aber noch ohne Punk und Electro. Wenn du mich fragst, hatten die Künstler damals den Dreh heraus, wenn es darum ging die Exzentrik und Opulenz des Artrock der frühen 70er ins Hit- oder Radioformat zu destillieren. Das traf insbesondere auf ELO zu.
Du hast deine Hochzeit angesprochen. Verändern dich Ehe und damit einhergehende Verantwortungen auch als Musiker?
Ich darf mich glücklich schätzen, eine verständnisvolle Frau zu haben. Wir kennen uns schon seit der Zeit, als ich mich zum ersten Mal in Bands versuchte und noch Träume von einer tollen Musikerkarriere hatte. Deshalb begreift sie beispielsweise, dass ich mich nach einer langen Tour mit Bastille umso stärker in meine eigenen Arbeit hineinknien möchte. Keine Frage, dass sich daraus eine heikle Gratwanderung ergibt, auch weil die Musikbereiche, in denen ich tätig bin, sehr unterschiedlich sind. Da stehe ich in einer ausverkauften Arena, und tags darauf glotze ich in eine halbleere Kneipe, weshalb ich lügen müsste, um zu behaupten, das sei psychisch leicht zu verkraften. Trotzdem mute ich es mir zu – ich kann gar nicht anders. In meiner Jugend dümpelte ich lange als Songwriter, Sänger oder Bandleader herum und glaube daher, dass ich es dem Teenager in mir mit der bescheuerten Frisur schuldig bin, mein Allerbestes zu geben. Wäre ich ein vernünftiger Mensch, hätte ich meine eigenen Ideen längst ruhen lassen und mich darauf versteift, Session-Musiker zu sein. Ich bin jedoch nicht vernünftig, und das weiß auch meine Frau … hoffe ich zumindest.
Wie vereinbarst du nun dein Privatleben und Musik als „Job“?
Zunächst einmal habe ich einen Heidenspaß dabei, Gitarre und Keyboard zu spielen sowie dazu zu singen. Das ist eine enorme Leistung für mich und gewissermaßen der Lohn fürs stundenlange Üben, womit ich meinen Mitbewohnern früher tierisch auf die Nerven ging. Die momentane Situation ist insofern genial, weil ich meinen Lebensunterhalt mit etwas bestreiten darf, dass für meine musikalischen Interessen sehr, sehr wichtig ist; demnach kann ich auch weiterhin, obwohl ich keinen Penny als Künstler Charlie Barnes verdiene – genaugenommen lege ich sogar drauf – und melodramatische Popsongs schreibe, unser Einkommen sichern, indem ich Charlie Barnes, der Zuarbeiter anderer Musiker bleibe. Auf diese Weise finanziell über die Runden zu kommen ist von unschätzbarem Wert.
Ich würde sagen, dass deine aktuellen Stücke danach schreien, von einer richtigen Band live umgesetzt zu werden, also nicht mehr mit Laptop und zahllosen anderen Instrumenten wie bisher. Gibt es Pläne dahingehend?
Nicht nur das. Gestern Abend bin ich zum ersten Mal mit meiner Band aufgetreten. Wir sind ein Trio, neben mir Drummer Ste, der bisher auf allen meinen Veröffentlichungen getrommelt hat, und mein guter Freund Ed, der früher der Gruppe Fish Tank angehörte und sowohl Bass als auch Gitarre, Keyboard und zusätzlichen Gesang übernimmt. Damit das funktioniert, müssen wir einige Kniffe anwenden, denn wir reden ja von ziemlich aufwändigen Arrangements, die ich gemeinsam mit Steve Dubrose ausgeheckt habe. Bei Konzerten mit einer kompletten Band kommt es aber vor allem auf eine intensive Darbietung an. Ich bin froh, Leute um mich zu wissen, die verstehen, wie man die Emotionen, die den Songs zugrunde liegen, aufs Publikum übertragen kann. Nach den kommenden Gigs hier in Großbritannien schauen wir, wie es in dieser Hinsicht weitergeht. Im April trete ich auch solo vor Bastille auf, was spannend wird, weil ich das Material nur mit Gitarre und Stimme vortragen will. Beim Ausarbeiten der Songs für „Oceanography“ legte ich großen Wert darauf, dazu in der Lage zu sein, weil ich in der Vergangenheit manchmal das Gefühl hatte, mich zu übernehmen, wenn ich das Zeug allein auf der Bühne umsetzen wollte.
Zu den Texten: ‚Bruising‘ scheint von dem Spagat zu sprechen, den man vollführen muss, wenn man es allen recht machen möchte. Ist man dabei unweigerlich zum Scheitern verurteilt?
Ich bin zweifelsohne ein sensibler Kerl, vermutlich zu empfindlich fürs Musikbusiness, um ehrlich zu sein … In ‚Bruising‘ beziehe ich mich auf den Gegensatz zwischen Shows in vollgepackten Häusern und dem Eindruck kurz darauf, als Solokünstler oder Songwriter versagt zu haben. Ich schätze, dieses Stück zu schreiben trug dazu bei, dass ich eine Trennlinie zwischen diesen beiden Aspekten meines Lebens als Musiker ziehen und mir ihrer genauer bewusst werden konnte.
‚One Word Answers‘ scheint sich mit der vorherrschenden Tendenz im gegenseitigen Austausch zu beschäftigen, Sachverhalte zu vereinfachen und zu pauschalieren, was zu folgenschweren Missverständnissen führen mag. Verlieren wir unsere Kommunikationsfähigkeit allmählich?
Das ist interessanterweise der älteste Text auf dem Album. Der Refrain und Prä-Chorus wurden vor etwa 15 Jahre geschrieben, als ich noch in einer Schulband spielte. Ich machte einen Song daraus, mit dem ich Innenschau und Abschottung nach außen bis zu einem gewissen Grad rechtfertige. Man kann es vielleicht als Variation darauf betrachten, was Roger Waters mit „The Wall“ ausdrücken wollte – ein Gefühl von Getrenntheit oder Entfremdung, wobei ich mir vor Augen halten musste, dass so ziemlich jeder Mensch solche Empfindungen erlebt. Möglicherweise ist es kein Zufall, dass ich eine Idee aus meiner Pubertät wiederaufgegriffen habe, nun da ich auf die 30 zugehe …
‚Legacy‘ ist ein bedeutungsschwangeres Wort, das viele Assoziationen zulässt; ohne zu viel hineindeuten zu wollen – wächst in dir das Bedürfnis, ein „Vermächtnis“ für nachkommende Generationen zu hinterlassen, je älter du wirst?
Na ja, eigentlich ist das nur Gejammer über meine zeitweilige Arbeit in einem Caféhaus, deretwegen ich unzufrieden mit mir selbst wurde, weil ich meine Kreativität verkümmern ließ. Ich finde, gerade dieser Text und die zugrundeliegende Idee stehen bezeichnend für meine Generation. Unsere Eltern sehen ihre Kinder und das Eigenheim als Vermächtnis an, das sie ihnen hinterlassen, wohingegen wir selbst viel narzisstischer sind. Wir möchten als möglichst coole oder irgendwie erfolgreiche Typen in Erinnerung gehalten werden. Ich habe irgendwann eingesehen, dass es mir als Musiker bei aller Leistungs- und Geltungssucht darauf ankommt, schlicht zu komponieren, zu spielen und den gesamten Vorgang zu genießen. Bestimmt kamen mehrere Faktoren dabei zusammen, dass ich meine Einstellung geändert habe. Während ich mich anstrenge, den ganzen geschäftlichen Kram so weit wie möglich von mir zu weisen, nehme ich mir vor, mir im Rahmen des Machbaren treu zu bleiben und die beste Musik zu schaffen, zu der ich imstande bin. Kunstschaffen darf kein Beliebtheitswettbewerb sein.
Hast du dich jemals davor gescheut, mit deinen Texten zu intim zu werden?
Es gab Zeiten, da hätte ich das fraglos besser getan, doch nein. Was ich aber jetzt loswerden muss, drücke ich in der Regel subtil verschleiert aus. Dadurch kann sich der Hörer seinen Teil dazudenken. Auch das ist häufig ein schwieriger Spagat und mit der Grund dafür, dass ich sehr lange brauche, um mit einem Stück abzuschließen. Da all die Musik unter meinem Namen herausgekommen ist, überlege ich mir mittlerweile sehr genau, was ich von mir gebe. Man kann sagen, dass ich alles, was den Leuten an meinen Sachen nicht gefällt, auf mich persönlich beziehe. Einen so hohen Stellenwert nimmt dieses Projekt bei mir ein. Darum mache ich mir große Sorgen über Dinge, die realistisch betrachtet kaum ins Gewicht fallen, weil sie sowieso niemandem beim Hören auffallen. Deswegen habe ich im vergangenen Jahr auch eine andere Band gegründet, The Society Pages. Mein Freund Ben, der auch als Tontechniker für mich arbeitet, spielt mit mir zusammen so eine Art von Country Folk oder Americana, wozu ich mir eine völlig andere Ausdrucksweise als bei meinem Solozeug angewöhnt habe. Die Texte lesen sich weniger rätselhaft, sind sehr offen gehalten und sachlich. Im Zuge dessen kann ich Witze darüber machen, wie übertrieben ernst ich Charlie Barnes nehme, und wesentlich unverkrampfter über persönliche Angelegenheiten schreiben; ein Song handelt von Sehnsucht nach meiner Frau, ein anderer vom Tod meiner Mutter, doch kein Text ist so hochtrabend formuliert wie jene meiner Solostücke, sondern nüchterner. Das macht soweit Spaß.
Marias wurden schon oft besungen; wer ist deine ‚Maria‘?
Es handelt sich um eine Geistergeschichte, auf die ich kam, nachdem ich mir eines Morgens eingebildet hatte, im alten Haus meiner Ehefrau ein Gespenst zu sehen. Da ich nicht an Spuk glaube, tue ich mich immer noch schwer damit, nachzuvollziehen, was da passiert ist.
In Anbetracht deiner musikalischen Entwicklung bis zu „Oceanography“: Wo sieht sich Charlie Barnes selbst in fünf oder zehn Jahren?
Wahrscheinlich mache ich einfach so weiter wie bisher. Allerdings schweben mir schon gewisse Dinge für mein nächstes Album vor; insbesondere will ich nicht mehr nur über mich selbst schreiben. Die Ideen sind aber noch vage, also abwarten. Im Augenblick bin ich heilfroh, hauptberuflich Musik machen zu dürfen, was langfristig auch so bleiben soll. Was ich parallel dazu solistisch treibe, wird wohl immer mit Anstrengungen verbunden sein, aber vielleicht entsteht gerade dadurch die beste Musik überhaupt. Ach was, eigentlich wünsche ich mir nichts so sehr, als einfach nur zu singen. Dabei fühle ich mich am glücklichsten. Eventuell schaffe ich es demnächst, meinen Traum von einem Projekt zum Tribut an Roy Orbison umzusetzen. Das war jetzt ein Scherz …
https://www.facebook.com/charliebarnesmusic/
- Charlie Barnes - Oceanography (2018)
- Charlie Barnes - Last Night's Glitter (2020)
















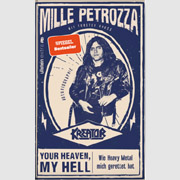






 Kontakt
Kontakt
