Partner
Services
Statistiken
Wir
Queensrÿche - Queensrÿche - Massen-Review
 Natürlich stellt sich die Frage, wer die "echten" QUEENSRŸCHE sind - die Band, die Geoff Tate weiterführt oder die Band, die von seinen ehemaligen Mitmusikern mit dem neuen Sänger Todd La Torre unter diesem Namen ein Album namens "Queensrÿche" veröffentlicht!? Die Allgemeinheit ist sich weitestgehend einig darin, dass letztere den Namen mit Recht tragen - auch weil sie sich auf die musikalischen Wurzeln der Band besinnen. Das wiederum mögen Tate-Anhänger anders sehen, klar ist aber, dass diese Schmierenkomödie eigentlich nur peinlich ist. Als peinlich wird allerdings mitunter auch "Frequency Unknown", das Album der Tate-QUEENSRŸCHE angesehen - wie also schlägt sich die andere Band auf "Queensrÿche"? Grenzenlose Euphorie sieht zwar anders aus, aber der Weg scheint der richtigere zu sein.
Natürlich stellt sich die Frage, wer die "echten" QUEENSRŸCHE sind - die Band, die Geoff Tate weiterführt oder die Band, die von seinen ehemaligen Mitmusikern mit dem neuen Sänger Todd La Torre unter diesem Namen ein Album namens "Queensrÿche" veröffentlicht!? Die Allgemeinheit ist sich weitestgehend einig darin, dass letztere den Namen mit Recht tragen - auch weil sie sich auf die musikalischen Wurzeln der Band besinnen. Das wiederum mögen Tate-Anhänger anders sehen, klar ist aber, dass diese Schmierenkomödie eigentlich nur peinlich ist. Als peinlich wird allerdings mitunter auch "Frequency Unknown", das Album der Tate-QUEENSRŸCHE angesehen - wie also schlägt sich die andere Band auf "Queensrÿche"? Grenzenlose Euphorie sieht zwar anders aus, aber der Weg scheint der richtigere zu sein.
Review von: Andreas Schulz (Profil)
Und dann haben sie mich doch noch gekriegt. Ich war bislang eigentlich der Meinung, dass ich QUEENSRŸCHE nicht wirklich brauche. Zwar steht der "Operation: Mindcrime"-Klassiker im heimischen CD-Regal, der hat es aber bislang nicht geschafft, mir die Notwendigkeit zu vermitteln, mich auch mit dem Rest der Frühwerke der Seattler zu beschäftigen Und dann kommt "Queensrÿche" daher und begeistert mich auf beinahe ganzer Linie. Und wenn man überall liest, dass sich das neue Album grob am Material von "The Warning" und "Empire" orientiert, dann bleibt eigentlich nur noch eine Schlussfolgerung...
Zurück zu "Queensrÿche" und zur schlechten Nachricht: das Album klingt nicht gut. Die Gitarren und sogar der Gesang wirken immer mal wieder übersteuert, kratzen an den Membranen und der Drumsound ist besonders bei der scheppernden Snare ebenfalls eine herbe Enttäuschung. Mix und Mastering lagen in den Händen von jemandem, der sich eigentlich auskennen sollte, denn James Barton war schon für den Sound bei "Operation: Mindcrime" und "Empire" zuständig. Unverständlich, warum er hier vergleichsweise miese Arbeit abgeliefert hat. Die gute Nachricht: das Songmaterial auf "Queensrÿche" ist so gut, dass man trotzdem von einem starken Album reden muss. An den nicht optimalen Sound gewöhnt man sich zudem, so dass man die Platte auch wirklich genießen kann.
Mit La Torre hat man sich den perfekten Sänger an Bord geholt. Dass er die alten Klassiker singen kann, hat er auf der Bühne beim Rock Hard Festival eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und auch bei den neuen Songs glänzt er, seine Stimme ist etwas mehr „Metal“ als die seines Vorgängers, zudem beherrscht er auch die dramatischen Passagen nahezu perfekt. Dass sich bei den ersten Gitarrenharmonien und Gesangslinien von "Where Dreams Go To Die", das auf das Intro "X2" folgt, die feinen Härchen auf den Armen zu einer Gänsehaut aufstellen, sagt alles. Über balladeske Strophen geht es in einen wunderbaren, leicht schwermütigen Refrain - ein großartiger Einstieg. Härter und kühler im Riff ertönt "Spore" und auch hier ist der eindringliche Refrain wieder packend. Doch es wird noch besser: das sehr melodische "In This Light" ist ein Paradebeispiel für traumhafte Gesangslinien und mit seinem Niederknie-Refrain eines der ganz großen Highlights des Albums.
Das bereits bekannte "Redemption" kann das Niveau nicht ganz halten - selten genug, dass Vorabsongs nicht zu den besten einer Platte gehören. "Vindication" zieht Härtegrad und Tempo an, ist im Vergleich mit den vorherigen Nummern aber in der Grundstimmung positiver. Auf das Zwischenspiel "Midnight Lullaby" folgt das wiederum düsterere, ruhigere und orchestral ausstaffierte "A World Without", bei dem auch der eindringliche Text seine Wirkung nicht verfehlt. "Don’t Look Back" und das ebenfalls schon bekannte "Fallout" sind ordentliche Nummern, aber keine Überflieger, das abschließende "Open Road" schließt die Platte mit erneut ruhigeren Tönen ab.
FAZIT: Das mit 35 Minuten (zu) kurz geratene Album ist zwar nicht mängellos, beweist mit einigen hervorragenden Songs, welche Formation den Namen QUEENSRŸCHE wohl zurecht trägt. Und wie gesagt - ich muss nun tatsächlich mal ran an den alten Speck.
12 von 15 Punkten
Review von: Daniel Fischer (Profil)
Das erste Album von QUEENSRYCHE nach der Trennung von Geoff Tate muss viel beweisen. Nicht nur, dass die Gesangsikone adäquat ersetzt wurde, sondern auch, dass die Band in kreativer Hinsicht auf eigenen Füßen stehen kann.
Die erste Hürde überspringt der ehemalige CRIMSON-GLORY-Sänger Todd La Torre relativ mühelos. Er erinnert immer wieder mit einer Note hier oder einer Phrasierung dort an die besten Zeiten seines Vorgängers (die dieser lange hinter sich gelassen hat). Dadurch wird das vertraute Gefühl der klassischen QUEENSRYCHE heraufbeschworen, ohne jedoch zu einer bloßen Kopie zu verkommen. Auch wenn er live bereits bewiesen hat, dass er alle Songs singen kann, Todd La Torre begeht nicht den Fehler, den frühen Geoff Tate zu imitieren. Stattdessen singt er sehr abwechslungsreich und emotional, oft auch etwas kerniger und rauer und nur selten extrem hoch.
Der zweite wichtige Punkt betrifft im Prinzip den Kern des Disputs zwischen der Band und Geoff Tate. Letzterer ließ seit dem Split keine Gelegenheit aus, den Input seiner ehemaligen Kollegen klein zu reden und sich selbst als musikalisches Mastermind darzustellen. Fakt ist, dass er sich auf den letzten gemeinsamen Alben lieber von fremden Komponisten mit Material versorgen ließ. Das klang rein musikalisch selten nach QUEENSRYCHE, und zwar immer nur dann, wenn die typischen Performance-Trademarks seiner Bandkollegen die Songs aufwerten konnten (man höre z.B. Teile von "American Soldier"). Die Essenz des QUEENSRYCHE-Sounds kann also weder auf einen einzelnen Komponisten (das wäre dann ohnehin eher der 1997 ausgestiegene Chris DeGarmo), noch auf die Stimme reduziert werden. Die Band wiederum ließ ihren ehemaligen Frontmann zu lange gewähren, wollte nun aber wieder zu einer organischen Arbeitsweise zurückkehren. Alle neuen Songs wurden gemeinsam von der gesamten Band ohne Außenstehende ausgearbeitet. Man wollte sich dabei an den früheren Alben orientieren und holte mit James Barton auch den bewährten Toningenieur zurück ("Operation: Mindcrime", "Empire" und "Promised Land").
Kann die Band aber nun Geoff Tate Lügen Strafen? Sie kann, denn die neuen Songs beleben endlich wieder viele der typischen Elemente, die nach "Promised Land" mehr und mehr verloren gingen: die zweistimmige Gitarrenarbeit, der hymnische, theatralische Gesang, das dominante Bass-Spiel, diese gewisse dramatische Grundstimmung und das akzentuierte, die Songs prägende Drumming. Gleichzeitig klingt "Queensryche" wie keines der alten Alben, sondern in gewisser Weise originell, und auch das war eines der Merkmale der klassischen QUEENSRYCHE. Die stilistische Ausrichtung wechselte jeweils von Album zu Album, die Band war aber aufgrund der genannten Trademarks sofort identifizierbar. So ist es auch hier, es wurden keinesfalls alte Songmuster kopiert, sondern mit Hilfe der bekannten Stilmittel neue, ehrliche Songs geschrieben, ohne sich an bestimmte Hörergruppen anzubiedern. Die Band hat spürbar wieder Spaß am Komponieren, Arrangieren und Spielen der eigenen Stücke.
Trotzdem gelingt es nicht ganz, auch den letzten Zweifel aus der Welt zu räumen. QUEENSRYCHE zeigen zwar, dass sie nicht nur ohne ihren ehemaligen Frontmann zu Recht kommen, sondern als echte Bandeinheit wieder musikalisch stärker klingen. Aber es bleibt weiterhin offen, ob sie den Weggang Chris DeGarmos jemals hundertprozentig werden kompensieren können. Die geringe Laufzeit ist dabei kein Problem. Nach einem Durchlauf hat man tatsächlich das Gefühl, ein komplettes, rundes Album gehört zu haben, obwohl sich die Band auf kurze, knackige Songs konzentriert. Das Material macht Spaß und lässt sich ohne Skip-Taste gut durchhören. Allerdings mangelt es an echten Hits, und auch die Höhepunkte wie der Opener "Where Dreams Go To Die" benötigen etwas Eingewöhnungszeit. Viele Refrains wirken flach, man wartet oft vergeblich auf eine deutliche Steigerung innerhalb der Songs. Mit dem in der Art moderner Radio-Hits gehaltenen "In This Light" hat man eigentlich nur einen sehr eingängigen Track zu bieten. Andere Nummern wie "Vindication", "Don't Look Back" oder "Fallout" rocken zwar musikalisch schön direkt und mitreißend, es fehlt aber eine große Melodie. Dafür packt man an anderer Stelle endlich wieder die typische Dramatik inklusive Orchestrierung aus: Während das düstere "A World Without" rein stimmungstechnisch fast auf "Operation: Mindcrime" stehen könnte, hätte das abschließende "Open Road" auch gut auf "Empire" gepasst.
Leider erschwert der Sound zusätzlich den Zugang zu den Songs. Alles wirkt sehr komprimiert, oft übersteuert und teilweise fast verzerrt, besonders das Schlagzeug klingt unnatürlich. Die Songs enthalten viele kleine Details und Nuancen, die aber leider etwas untergehen, weil der Mix sehr anstrengend anzuhören ist. Nicht zuletzt dadurch bleiben einige Hooks etwas flach, weil z.B. kleine Akkordverschiebungen der Gitarren nahezu verschwinden. Gerade bei einer Band wie QUEENSRYCHE wäre ein aufgeräumter, luftiger Mix nötig, der jedem Instrument und jeder Frequenz seinen Platz lässt und sie nicht gegeneinander kämpfen lässt. Hier hat sich leider die Rückkehr von James Barton nicht bezahlt gemacht.
FAZIT: Es ist sicher nicht das glorreiche Comeback, dass man sich gewünscht hätte, aber das wäre wohl auch zu viel erwartet. Stattdessen handelt es sich bei "Queensryche" um eine Art "Reset", alles wird wieder auf Null gesetzt und die Zeit nach Chris DeGarmos Ausstieg fast ausgeblendet. Das Album enthält viele der typischen Elemente der klassischen ersten Werke, jedoch verpackt in frische, vielfältige Songs, die keinesfalls altbekannte Nummern nachahmen. Somit stehen von hier aus alle Wege offen, das Potential ist da, wird aber noch nicht ausgeschöpft. Ausfälle gibt es keine, jede Menge gutklassiges Material, jedoch auch nur wenig wirklich Überragendes. Da man froh ist, dass QUEENSRYCHE sich von Egomane Geoff Tate emanzipieren konnten und das Album fast wie ein Debüt wirkt, kommt die Band diesmal trotz Schwächen beim Sound mit einer guten Bewertung davon. Das nächste Mal sollte dann aber eine Steigerung erfolgen.
11 von 15 Punkten
Review von: Lothar Hausfeld (Profil)
Schon komisch, dass man als Fan derart hohe Erwartungen an ein neues Album einer Band hat, die das letzte wirklich relevante Werk vor knapp 20 Jahren veröffentlicht hat. Denn, mal ehrlich, alles, was QUEENSRYCHE seit "Promised Land" zustande bekommen haben, war allenfalls in homöopathischen Dosen essenziell und qualitativ mit den frühen Geniestreichen der Band auf Augenhöhe.
Doch mit dem Sängerwechsel machte sich die Hoffnung breit, dass nunmehr eine Rückkehr zum alten Sound stattfinden werde. Dass Ex-Frontmann Geoff Tate keine sonderliche Lust verspürte, sich zu "Operation: Mindcrime" und ähnlichen Großtaten zu bekennen, endete in Vollkatastrophen wie "Dedicated To Chaos", und insofern schien der Wechsel am Mikrofon mit Neusänger Todd La Torre die Rückkehr zu alter Stärke zu bedeuten. Zumindest, was erste Auftritte der "neuen" QUEENSRYCHE an Rückschlüssen zuließen.
Doch schon vor dem Abspielen des schlicht "Queensryche" betitelten "Comebacks" ein erster Rückschlag: Die ausgesprochen kurze Spielzeit von gerade einmal 35 Minuten - ein Hinweis darauf, dass hier nur schnell ein neues Album auf den Markt gebracht werden soll? Ausdruck künstlerischer Defizite?
Nach dem ersten Durchlauf lautete die Antwort ganz eindeutig "ja". Wahrscheinlich waren die Erwartungen an dieses Album schlicht und ergreifend zu hoch. Der stark komprimierte und höhenlastige Sound tat das seinige, um den Kritiker erst einmal enttäuscht zurückzulassen. Einzig die Leistung von La Torre imponierte - mehr als einmal klingt der Ex-CRIMSON-GLORY-Sänger nach dem jungen Geoff Tate. Und der gilt ja nicht gerade wenigen Fans als der beste Metalsänger überhaupt.
So nach und nach aber, mit jedem weiteren Durchlauf, wuchs die Freude über das Gehörte. "Where Dreams Go To Die", in einer ersten Enttäuschung noch als "nicht weit weg vom Sound der letzten Alben" verortet, wächst zu einem beeindruckenden Laut-Leise-Wechselspiel. "Redemption" gerät zum Hit, "Vindication" begeistert mit mitreißender Dynamik, wie man sie vielleicht seit "The Needle Lies" nicht mehr von QUEENSRYCHE gehört hat. "A World Without" zeigt, wie man eine Ballade ohne Anbiederung ans Radio schreibt, "Don't Look Back" ist ein Paradebeispiel für melodischen Metal mit feinen Twin Guitars.
Dass am Ende aber doch nicht alles Gold ist was glänzt, liegt an zwei negativen Punkten. Zum einen: der Sound. Wie bereits erwähnt, klingt "Queensryche" merkwürdig unfertig, das Schlagzeug scheppert, was angesichts der Spielfertigkeit eines Scott Rockenfields eine kleine Frechheit ist. Und zum anderen: An der einen oder anderen Stelle fehlt den Songs der große Moment, die alles überstrahlende Melodie. Alles, was auf "Queensryche" passiert, ist gut. Mindestens. Aber vieles ist eben auch nicht mehr als gut.
FAZIT: "Queensryche" ist trotz aller Kritik ein gelungenes Ausrufezeichen einer Band, die nach jahrelanger Talfahrt beweist, dass sie mit dem Wechsel am Mikrofon noch einmal zum großen Neuangriff blasen will. Mit einer reinen Rückbesinnung auf alte Alben hat sich die Band nicht begnügt, was ihr zweifelsfrei hoch anzurechnen ist. Vielmehr ist das selbstbetitelte Werk ein Mix aus "Empire", insbesondere was die kühle Stimmung betrifft, und "Rage For Order". Dass der Kritiker am Ende mehr erwartet hatte, ist letztlich sein eigenes Problem.
11 von 15 Punkten
Review von: Lutz Koroleski (Oger) (Profil)
Nach dem Ausstieg von Geoff Tate und der mehr als unwürdigen Schlammschlacht im Anschluss, gab es im April bereits ein musikalisches Lebenszeichen des ehemaligen Sängers nebst Mietmusikern, das dem letzten regulären QUEENSRYCHE-Album qualitativ kaum nachstand, sprich nahezu unhörbaren, belanglosen Schrott enthielt.
Nun legt der Rest der Band nach, verstärkt um den ehemaligen CRIMSON GLORY-Fronter Todd La Torre, der bereits live seine Klasse bei der Interpretation von QUEENSRYCHE-Klassikern unter Beweis stellen konnte.
Trotzdem durfte man angesichts der im Vorfeld bereits veröffentlichten Stücke kritisch sein. Sowohl "Redemption" als auch "Fallout" gehen zwar als solide Vertreter durch, sind aber – vom Gesang abgesehen – ein gutes Stück entfernt von früheren Qualitätsstandards. Was man als Fan in solchen Fällen eigentlich erhofft, aber selten eintritt, ist hier tatsächlich einmal der Fall. Fast alle noch unbekannten Songs auf "Queensryche" übertreffen die beiden Vorab-Songs und erfüllen die hochgesteckten Erwartungen.
Nach dem von den Sprachsamples her an "NM156" erinnernden Intro "X2" geht es mit "When Dreams Go To Die" ebenfalls im "Warning"-Fahrwasser gleich zünftig los. Die balladeske Strophe verbreitet wieder Gänsehaut statt Mitleid, La Torre singt schlicht großartig und der von einem echten Metal-Riff und den typischen QR-Gitarren-Harmonien getragene Refrain lässt keine Wünsche offen. Auf solche Songs hat man streng genommen seit "Promised Land" gewartet. Ein Auftakt nach Maß. "Spore" klingt moderner. Ein hartes, grooviges Prog-Riff bildet die Basis und führt zu einem erneut majestätisch-eingängigen Refrain. Auch bei "In This Light" wartet man vergeblich auf den ersten schwachen Moment. Der von orchestralen Keyboards untermalte Songhöhepunkt hat vielmehr mit das größte Ohrwurmpotential des Albums. Im Anschluss folgt mit "Redemption" eine kleine Atempause, während mit dem flotten "Vindication" fast so etwas wie positive Stimmung verbreitet wird. Ein gelungenes Experiment und ein wirklich guter Song. Mit dem finsteren "Midnight Lullaby" wird "A World Without" eingleitet, das in der Tradition der großen Band-Balladen wie "Road To Madness" oder "Silent Lucidity" steht und mit einem bombastischen Chorus punktet. Sehr stark. "Don´t Look Back" ist dann der einzige "neue" Song, der die Vorab-Beiträge nicht topt und sich dem sich anschließenden "Fallout" qualitativ anpasst. Zum krönenden Abschluss folgt schließlich "Open Road", das erneut getragene, epische Töne anschlägt und die meisten Fans beglückt zurücklassen dürfte.
So weit, so erfreulich. Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Obwohl das Songwriting wieder überzeugt, hapert es massiv am Sound. Über die Ursache kann man nur spekulieren, aber im Endeffekt klingt das Album deutlich übersteuert. Vor allem der Bass knarzt, bei einigen Passagen brummt es aber auch insgesamt gewaltig. Hinzu kommt, dass die Höhen zu weit im Vordergrund stehen und das Schlagzeug bisweilen sehr dünn und künstlich klingt, vor allem die Snare. Schade, auch wenn man sich im Laufe eines Hördurchganges etwas daran gewöhnt.
FAZIT: "Queensryche" zerlegt "Frequency" locker im Vorbeigehen und ist die stärkste Veröffentlichung unter dem QR-Banner seit fast 20 Jahren. Ohne anachronistisch zu klingen, nimmt es Bezug auf die glorreichen Vergangenheit, enthält mindestens fünf Volltreffer und keine Ausfälle. Das Ganze wird garniert mit fantastischem Gesang, einer gesunden Portion Härte, aber leider auch mit suboptimalem Sound. Trotzdem ein insgesamt erfreulich starkes Album.
11 von 15 Punkten
Durchschnittspunktzahl: 11,25 von 15 Punkten.
Damit Einstieg auf Platz 14 in den Massen-Review-Charts.















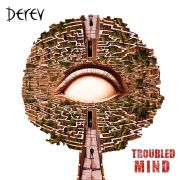







 Kontakt
Kontakt
